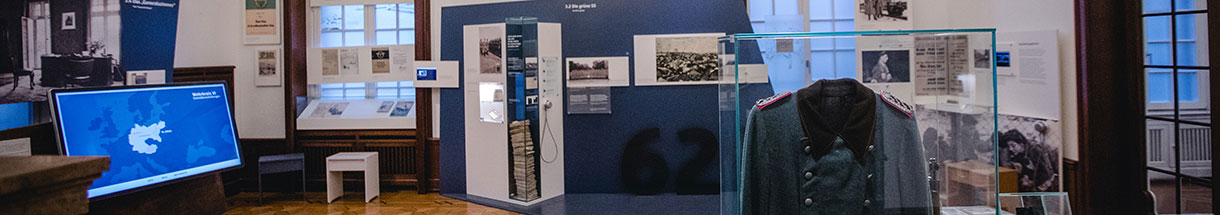Seiteninhalt
Anderes Land – gleiche Prinzipien?
Historisch-politische Bildungsarbeit mit Polizistinnen und Polizisten im Maison d'Izieu
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Villa ten Hompel und das Maison d’Izieu. Ist erstere ein polizeilicher Täterort, so widmet sich die französische Gedenkstätte nahe Lyon Verfolgungsgeschichten und stellt Geschichten von Hilfsbereitschaft und Mut in den Vordergrund. Dennoch sind unter den mehr als 30.000 Besuchenden der Gedenkstätte viele Polizistinnen und Polizisten, die sich in Halbtages- und Tagesprogrammen mit der Geschichte des Ortes beschäftigen und darüber diskutieren, welche Bezüge Geschichte eigentlich zu ihrem beruflichen und persönlichen Alltag hat.
Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der historisch-politischen Bildungsarbeit mit Polizeikräften an Gedenkstätten tauschte sich Mitarbeiterin Kim Sommerer mit Alexandre Nugues-Bourchat, Leiter der Vermittlungsarbeit des Mémorial d'Izieu, aus.
„Aus Versehen würde wohl niemand über die Gedenkstätte stolpern“, sagt Alexandre Nugues-Bourchat. Er ist Leiter der Vermittlungsarbeit in der Gedenkstätte Maison d'Izieu, etwa eine Stunde Fahrtweg entfernt von Lyon oder Urlaubsorten wie Annecy. Mitten auf dem Land gelegen und ohne gute Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs kommt wohl tatsächlich kaum jemand zufällig an dem Gelände des Erinnerungsortes vorbei. Dennoch ist das Haus in der kleinen Gemeinde Izieu heute eine wichtige und bekannte Gedenkstätte in Frankreich.
Hier errichteten Sabine und Miron Zlatin ein Kinderheim, in dem sie zwischen 1943 und 1944 insgesamt mehr als einhundert jüdische Kinder aufnahmen, um sie vor der Verfolgung zu schützen. Trotz ihrer Bemühungen wurden die im April 1944 noch dort lebenden Kinder samt der Erzieherinnen und Erzieher von der Gestapo unter Verantwortung des damaligen Leiters der Gestapo Lyon, Klaus Barbie, verhaftet und meist nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur eine Person überlebte.
In Münster zeigt die Bushaltestelle Aegidiimarkt A/LWL-Museum seit 1987 ein Bild des Strafprozesses gegen Klaus Barbie, der mit Hilfe zweier Mütter von aus Izieu deportierten Kindern verhaftet werden konnte. Durch den Prozess wurden das Maison d'Izieu und das Schicksal der Kinder und Erzieher/-innen in ganz Frankreich bekannt.
1994 wurde die Gedenkstätte zu ihrer Erinnerung eingeweiht. Der damalige französische Präsident François Mitterrand stellte dabei drei Eigenschaften des historischen Ortes heraus: Er sei ein „lieu de vie, un lieu de mémoire, et un lieu d'éducation“ - Ein Ort, an dem einst Kinder gelebt hatten, an die nun mit der Gedenkstätte erinnert werden sollte, und ein Bildungsort. Seither werden hier Seminare mit Schulklassen aus Grund- und weiterführenden Schulen durchgeführt. Aber die Vermittlungsarbeit der Gedenkstätte richtet sich nicht allein an junge Menschen, sondern an die gesamte Gesellschaft und an einzelne Berufsgruppen im Besonderen. So schloss sich der damalige Präsident François Hollande bei der Erweiterung der Gedenkstätte 2015 an die Ausführungen seines Vorgängers an: die Gedenkstätte von Izieu sei auch ein „Ort des Engagements“, ein „Ort der Brüderlichkeit“ und ein „Ort der Republik“. Also ein Ort, der die Werte und Prinzipien der Republik (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) verdeutlicht, so Nugues-Bourchat. Prinzipien, für die Polizistinnen und Polizisten in ihrem Beruf einstehen und die sie verteidigen sollen. Einmal im Monat bis alle 14 Tage besuchen daher Polizeibeamte der Gendarmerie und Police Nationale das Maison d'Izieu.
Etwa eineinhalb Stunden erhalten die Polizekräfte die Möglichkeit, die Ausstellungen zu erkunden und zu erfahren, wieso in Izieu Kinder unterkamen, einige gerettet und andere deportiert wurden. Wenn sie nur den historischen Ort kennenlernen und über die Geschichte der Résistance und Kollaboration in Frankreich sowie die Rolle sprechen würden, die die polizeiliche Verwaltung bei der Verfolgung der jüdischen Kinder spielte, hätte die Gedenkstätte aber ihr Ziel verfehlt, wirft Nugues-Bourchat ein. Anhand von biografischen Fallbeispielen und Quellenstudien reflektieren die Seminarteilnehmenden daher über die berufliche Verantwortung von (Polizei-)Beamten und die geforderte Loyalität und den Gehorsam bei der Ausführung von Anordnungen, die auch heute noch in der Polizeiarbeit vorherrschen. Hierüber diskutieren vor allem diejenigen, die Commissaire oder Officier de Police werden wollen, sich also im Rahmen eines Masterstudiums bzw. nach mehrjähriger Berufspraxis weiterbilden möchten.
Genau wie in den Formaten der Villa ten Hompel stellt sich dabei die Frage, wie „ganz normale Männer“, wie Polizisten Folterer und Mörder werden konnten, die sich an den nationalsozialistischen Verbrechen und denen des Vichy-Regimes beteiligten und dabei auch eigenständig Handlungsspielräume zum Negativsten ausnutzten. Immer unter der Maßgabe, dass die Polizei geltende Gesetze ausübt und die öffentliche Ordnung sicherstellt – aber mit der Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob die erhaltene, durch Gesetz legalisierte Anordnung auch legitim und moralisch vertretbar war, und wie man sich zu illegitimen Anordnungen verhalten könnte.
So schildert Nugues-Bourchat das Beispiel eines Polizisten, der seinen Beruf als Polizist verließ, weil Befehle seine individuelle Grenze des Handelns überschritten. Eine an der Moral orientierte Entscheidung. Trotzdem ließe sich hier darüber diskutieren, was der ehemalige Polizist nun noch ausrichten konnte. Hatten nicht Aktive im Polizeidienst vielmehr die Möglichkeit, Menschen zu helfen oder sie gar zu retten? Andererseits beteiligten sie sich im Rahmen des Berufes vielleicht an anderen Tagen an den nationalsozialistischen Verbrechen. Als Beispiel hierzu könnte auch Joseph Henneboehl aufgeführt werden, der in Lippstadt geboren und als Ordnungspolizist in den besetzten Niederlanden, etwa im Durchgangslager Westerbork eingesetzt wurde. Er erhielt in den 1980er Jahren den niederländischen Widerstandsorden verliehen, da er eine Gruppe katholischer Geistlicher vor der Deportation gerettet hatte, indem er sie unter einem Vorwand aus dem Lager herausführte und in ein Versteck brachte. Doch kann jemand als widerständig gelten, der sich an anderen Tagen an Deportationen und Razzien beteiligte?
In Halbtagesseminaren mit Auszubildenden der Police Nationale, die als Gardien de la Paix (im einfachen und mittleren Dienst) arbeiten werden, legen die pädagogischen Mitarbeitenden des Maison d'Izieu einen thematischen Schwerpunkt auf Stereotype und antisemitische, rassistische und weitere Vorurteile, aber auch solche, die Polizistinnen und Polizisten in der Gesellschaft zugeschrieben und in Medien verbreitet werden. In allen Seminaren sollen Bezüge zu den eigenen Lebenswelten der Polizeibeamten hergestellt werden. So begrenzen sich die Gesprächsthemen nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch Menschheitsverbrechen nach 1945 werden angesprochen und besonders heutige berufsethische Richtlinien der Polizei thematisiert.
Dabei ist, wie in der Bildungsarbeit der Villa ten Hompel, der offene Diskurs ein wichtiges Prinzip. „Mitarbeitende von Gedenkstätten kennen den polizeilichen Arbeitsalltag nicht im Detail und wissen nicht, wie es ist, Polizist oder Polizistin zu sein“, so auch Nugues-Bourchat. Aber vielleicht kann der Austausch gerade deshalb so wertvoll sein: Um einen Gesprächsanlass über ethische und moralische Konflikte im beruflichen Alltag zu schaffen und einen Perspektivwechsel zuzulassen. Dennoch kann es manchmal zu Meinungsverschiedenheiten in den Seminaren kommen, was etwa mit falschen Erwartungen zusammenhängen kann, dass das Seminar dazu diene, über Denk- und Verhaltensweisen der Seminarteilnehmenden – Polizeikräften wie Juristinnen und Juristen, Verwaltungsmitarbeitende oder Schülerinnen und Schüler – zu urteilen.
Insgesamt lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Formaten in der Villa ten Hompel und der Maison d'Izieu feststellen – durchaus anders als erwartet, da sich in Frankreich viele Seminare im schulischen und universitären Kontext sowie auch Führungen in Museen eher weniger partizipativ oder „auf Augenhöhe“ gestalten. „Das heißt aber auch, dass wir potentiell die gleichen Fehler in den Seminaren machen“, sagt Nugues-Bourchat. Um darüber zu sprechen, welche Quellen und Module gut funktionieren und welche nicht, befürwortet Nugues-Bourchat daher einen Austausch zwischen Gedenkorten und Museen, die sich mit der Vermittlungsarbeit mit Polizistinnen und Polizisten beschäftigen - und das nicht allein auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene.
Die Gedenkstätte Maison d'Izieu habe bereits viel im Austausch mit Mitarbeitenden deutscher Erinnerungsorte gelernt. Verschiedene Gedenkstätten aus Deutschland haben sich bereits in einem Arbeitskreis zusammengeschlossen. Geplant ist das nächste Austausch-Treffen im Frühjahr 2022 in Münster, bei dem unter anderem über die Konzeption hybrider und mehrtägiger Formate diskutiert werden soll. Vielleicht könnte der Kreis perspektivisch um weitere Gedenkstätten außerhalb Deutschlands ergänzt werden?
Homepage der Gedenkstätte Maison d'Izieu: www.memorializieu.eu/de